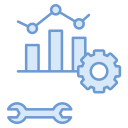Ihre 90-Tage-Route zum ersten Proof of Concept
Ziele schärfen, Randbedingungen sammeln, Daten auditieren. Ein kompaktes Referenzproblem definieren, das realistisch und repräsentativ ist. Früh Stakeholder einbinden und Abnahmekriterien klären, damit Erfolg später eindeutig messbar wird und niemand an den Zielen vorbeiarbeitet.
Ihre 90-Tage-Route zum ersten Proof of Concept
QUBO-Formulierung, hybride Heuristik wählen, Baseline festlegen. Mit synthetischen Daten starten, dann echte Daten schrittweise integrieren. Ergebnisse gemeinsam mit Dispatchern validieren, Annahmen korrigieren und ein kleines Feld live pilotieren – mit klaren Sicherheitsnetzen und Rückfalloptionen.